Projektbeschreibung
Die Vorprojekte der DUH und des Büros am Fluss („Lebendige Flüsse und kleine Wasserkraft“ und „Kartierung der Querbauwerke im Neckareinzugsgebiet“) zeigten, dass es weiterhin an konkreten Pilotvorhaben in nach den Ergebnissen der WRRL-Bestandserhebung als prioritär eingestuften Flussteileinzugsgebieten fehlt. Das bisher praktizierte Verfahren der autarken und zuweilen willkürlichen Modernisierung von Anlagen, die für den Betreiber finanzielle Hürden aufbaut und darüber hinaus nicht immer an der richtigen Stelle greift, soll möglichst verhindert werden. Stattdessen soll nun ein größerer Flussabschnitt betrachtet werden, an dem an den systematisch sinnvollsten Orten Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen werden.
In einem definierten Bereich im Einzugsgebiet des Neckars werden Betreiber von Kleinwasserkraftanlagen dafür gewonnen, sich zu einer Interessengemeinschaft zusammenzuschließen und als eine Einheit für die ökologische Verbesserung „ihres“ Flussabschnitts zu sorgen.
Den Weg hierhin ebnet die Entwicklung eines neuartigen und an die Erfordernisse der EU-Wasserrahmenrichtlinie angepassten Instrumentariums zur Förderung der ökologischen Modernisierung von Kleinwasserkraftanlagen. Dieses zu erstellende und anschließend in einem Untersuchungsgebiet im Neckareinzugsgebiet Anwendung findende Förderinstrumentarium wird nicht mehr rein Anlagen bezogen, sondern Gewässersystem bezogen sein. Anlagenbetreiber sollen vor diesem Hintergrund die Möglichkeit bekommen, eine Rechtsform zu bilden, beispielsweise eine Genossenschaft, die insgesamt in den Genuss der erhöhten Förderung des EEG kommt. Hierbei ist es nicht zwingend, dass das so mobilisierte Kapital an sämtlichen beteiligten Anlagen eingesetzt wird; Anlagen, an denen Modernisierungen ökologisch vorrangig sind, werden zuallererst bedacht. So ermöglicht dieser Ansatz Maßnahmen an der Stelle, an der sie den größten Nutzen bringen. Die größten Schwachstellen und ökologisch kritischsten Bereiche können nach einer sorgfältigen Prüfung identifiziert und entschärft werden. Diese Form der Problembehandlung hat im besten Fall sehr viel positivere Auswirkungen auf den gesamten Flussabschnitt als die Maßnahmen einzelner ehrgeiziger Anlagenbetreiber, die sich der ökologischen Beeinträchtigung ihrer Anlage bewusst und darüber hinaus bemüht und gewillt sind, diese in einen vertretbaren Zustand zu versetzen. Das Genossenschaftsmodell ermöglicht die Umsetzung von Maßnahmen, die mit der einfachen Förderung des EEG die Kapazitäten eines einzelnen Betreibers überschreiten würden. Das Augenmerk wird hier auf Flussabschnitte gerichtet, die nach der WRRL-Bestandsaufnahme als prioritär eingestuft werden und die die größte Aussicht auf eine Verbesserung des ökologischen Zustands versprechen.
Der Ansatz des Projekts sieht sich somit als verbindendes Element zwischen dem Anlagen bezogenen EEG und dem gewässersystemaren Anspruch der WRRL. Nachdem die WRRL-Bestandsaufnahme ergab, dass die eingeschränkte Durchwanderbarkeit der Gewässer eine wichtige Ursache dafür ist, dass es bei praktisch allen Gewässersysteme im Einzugsgebiet des Neckars fraglich ist, ob sie den guten ökologischen Zustand erreichen, ist dies von großer Dringlichkeit.
Die entsprechenden juristischen Fragestellungen zur angestrebten Rechtsform sind im Rahmen des Projekts zu klären. Des Weiteren müssen, möglichst in engem räumlichem Rahmen, regionale Wasserkraftbetreiber gefunden werden, die Interesse haben, an dem Vorhaben mitzuwirken.
Die sich aus dem Projekt ergebenden Resultate sollen als Vorbild für andere Flusseinzugsgebiete dienen und langfristig die verhärteten Fronten zwischen Wasserkraftbetreibern und Naturschützern lockern. Wir wollen zeigen, dass Klima- und Naturschutz nicht unvereinbar sind.
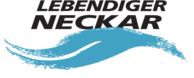
Kontakt
 © Steffen Holzmann
© Steffen Holzmann Ulrich Stöcker
Teamleiter Wildnis und Naturkapitalungen
E-Mail: Mail schreiben

