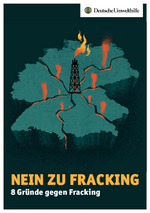Was ist LNG?
LNG (Liquefied Natural Gas) ist verflüssigtes Erdgas. Um das Gas per Schiff transportieren zu können, wird es in einem energieaufwendigen Prozess auf mindestens -161°C heruntergekühlt, bis es flüssig wird. An Terminals in den Importländern wird das Flüssiggas dann wieder aufgewärmt, um es in einen gasförmigen Zustand zu bringen und in das Erdgasnetz einzuspeisen. Dieser Vorgang heißt Regasifizierung.
Neun LNG Terminals waren auf Grundlage des LNG-Beschleunigungsgesetztes (LNGG) in Deutschland geplant. Vier schwimmende Terminals (FSRUs) sind derzeit in Brunsbüttel, Mukran und Wilhelmshaven in Betrieb. In Mukran war ein zweites schwimmendes Terminal geplant und auch in Stade sollte eine FSRU betrieben werden, beide Terminalschiffe beendeten ihren Betrieb jedoch bereits vorzeitig. Zudem sollen ab 2027 drei feste, landseitige LNG-Terminals in Stade, Wilhelmshaven und Brunsbüttel entstehen. In 2024 wurden etwa 8 % des gesamten deutschen Erdgasbedarfs von den deutschen Flüssiggasimporten gedeckt. Etwa 70% des nach Deutschland importierten LNG wird durch umwelt- und gesundheitsschädliches Fracking gefördert.
Die Deutsche Umwelthilfe spricht sich mit Nachdruck für Energie- und Versorgungssicherheit aus und damit gegen neue fossile Infrastrukturprojekte, da diese die dringend notwendige Energiewende blockieren. Um Energiesicherheit zu schaffen, müssen wir auf Zukunftstechnologien wie Energieeffizienz und -einsparungen, erneuerbare Energien, Batteriespeicher, Nachfrageflexibilität, grünen Wasserstoff und den Netzausbau setzen. Neue fossile Infrastruktur und langfristige Lieferverträge, die uns auf Jahre und Jahrzehnte an den Import von Fracking-Gas ketten, können nicht die Antwort auf die Krisen unserer Zeit sein. In den vergangenen Jahren hat sich die Debatte um den Import von flüssigem Fracking-Gas nach Deutschland zunehmend verschärft. Deutschland darf seine internationale Verantwortung gegenüber den Lieferländern und dem Klima nicht vernachlässigen. Es darf keinen weiteren Ausbau fossiler Infrastruktur geben!
Berechnungen führender energiewirtschaftlicher Institute sowie die Lageberichte der Bundesnetzagentur zeigen: Die Energie-Versorgungslage in Deutschland ist stabil. Im Juli 2025 stufte die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) die Alarmstufe Gas auf die Frühwarnstufe zurück. Eine weitere Bestätigung, dass es keine neuen Importterminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) braucht.
Als Folge der Energiekrise wurde das LNG-Beschleunigungsgesetzt am 24.05.2022 als Reaktion auf den erweiterten russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die darauffolgende Energiekrise in Europa verabschiedet, um LNG-Infrastruktur für Importe in großem Umfang beschleunigt auszubauen. Das Gesetz bildet die rechtliche Grundlage für die beschleunigten Genehmigungsverfahren der neuen LNG Terminals seit 2022. Seit Ende Juni 2025 sind die wesentlichen Teile des Gesetzes, welche die beschleunigten Verfahren ermöglichten, außer Kraft. Neue LNG-Infrastrukturprojekte können nicht mehr im Schnellverfahren genehmigt und umgesetzt werden.
Mit den beschleunigten Verfahren hebelte das LNGG notwendige Prüfpflichten und grundlegende Beteiligungsrechte für die Zivilgesellschaft aus. Die DUH hat das LNGG aus diesem Grund scharf kritisiert, insbesondere weil es geltendes Naturschutzrecht untergrub und Fristen auf ein nicht angemessenen Zeitrahmen verkürzte. Ein fossiler Lock-In, durch die zusätzliche fossile Infrastruktur sowie Schäden an ökologisch einmaligen Lebensräumen und die Bedrohung bereits gefährdete Arten wurden somit unter diesem Gesetz in Kauf genommen.
Die LNG Terminals werden auch mit dem zukünftigen Import von Wasserstoff gerechtfertigt. Da grüner Wasserstoff oder seine Derivate in den nächsten Jahren nicht ausreichend vorhanden sein werden und auch die Infrastruktur selbst dafür umgerüstet werden muss, erscheinen diese Pläne jedoch vage und unverbindlich. Statt die Energiewende voranzutreiben, wird also weiter in fossile, klimaschädliche Infrastruktur investiert: Deutschland steuert auf einen fossilen Lock-In zu.
FAQ
Das LNGG ist ein Gesetz, das geschaffen wurde, um den Ausbau der LNG-Infrastruktur in Deutschland zu beschleunigen. Es wurde im Mai 2022 verabschiedet. Seit Ende Juni 2025 sind wesentliche Teile des LNGG außer Kraft getreten (siehe § 14 LNGG). Nur vor dem Datum beantragte Vorhaben können noch von den beschleunigten Verfahren des LNGG profitieren. In diesen Schnellverfahren entfallen normalerweise verpflichtende Maßnahme wie die Umweltverträglichkeitsprüfung für schwimmende Terminals sowie die Anbindungspipelines. Zudem waren die Beteiligungsprozesse während der Genehmigungsverfahren deutlich verkürzt und die zivilgesellschaftliche Partizipation an diesen Verfahren dementsprechend erschwert. Das LNGG regelt außerdem, dass die LNG-Terminals bis 2043 mit flüssigem Erdgas betrieben werden dürfen. Danach dürfen ausschließlich Wasserstoff und Wasserstoffderivate geführt werden.
Ein von der DUH beauftragtes Rechtsgutachten zeigt, dass das LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG) in weiten Teilen europarechtswidrig ist und auf Annahmen basiert, die inzwischen überholt sind bzw. von Beginn an unzutreffend waren.
Mit dem LNGG wurden neun Terminals für den Import von Flüssigerdgas geplant. Vier dieser Terminals sind bereits in Betrieb. Bei voller Auslastung der Terminals wird ihr Betrieb einen Großteil des deutschen CO2-Restbudgets verbrauchen und die deutschen Klimaziele unerreichbar machen. Sogar mit sehr konservativen Annahmen, in denen die Emissionen aus Förderung, Verarbeitung und Transport nicht berücksichtigt werden, wäre der Großteil des CO2- Restbudgets aufgebraucht, das Deutschland zur Einhaltung des Pariser Klimalimits bleibt. Die geplanten Importkapazitäten sind weit höher als der Anteil russischen Gases, der, wenn überhaupt, ersetzt werden müsste. Damit opfert die Bundesregierung mit diesen vollkommen überdimensionierten Plänen grundlos die Klimaziele.
Die neun LNG-Terminals waren an fünf Standorten in Deutschland geplant: Wilhelmshaven, Stade, Brunsbüttel, Lubmin und Mukran.
Vier FSRUs sind seit Ende 2022 bzw. Anfang 2023 und Mai 2025 in Brunsbüttel, Mukran und Wilhelmshaven in Betrieb. Der Standort Lubmin ist verfallen, da das LNG Terminalschiff von dort nach Mukran verlegt wurde. In Mukran war zudem ein zweites schwimmendes Terminal geplant und auch in Stade sollte eine FSRU betrieben werden. Beide Terminalschiffe haben ihren Betrieb jedoch vorzeitig beendet. Ab 2027 sollen zusätzlich drei feste, landseitige LNG-Terminals in Stade, Wilhelmshaven und Brunsbüttel entstehen.
Nähere Informationen zu den Terminalplänen auf Rügen können im Hintergrundpapier LNG-Terminal Rügen nachgelesen werden.
Studien zeigen, dass Deutschland keine weiteren Importterminals für fossiles Erdgas braucht. Die deutschen LNG-Pläne beruhen auf höchst unwahrscheinlichen Szenarien. Es hat keine Gasknappheit gegeben.
Für 2030 liegt der Erdgasbedarf nach Angaben der Bundesregierung bei 74,1 Mrd. m³. Wenn alle LNG-Projekte wie geplant umgesetzt werden, hätte Deutschland im Jahr 2030 eine Überkapazität von über 50 Mrd. m³. Führende Wirtschaftsforscher*innen sind der Meinung, dass es angesichts der stabilen Gasversorgung und dem zurückgehenden Verbrauch keinen Bedarf für weitere LNG-Terminals gibt.
Die Lageberichte der Bundesnetzagentur sowie die Herabstufung der Alarmstufe Gas durch die Bundesnetzagentur im Juli 2025 unterstützen die Einschätzung, dass Deutschland sich in einer stabilen Versorgungslage befindet.
Durch den Neubau der Importterminals entstehen neue langfristige Abhängigkeiten. So ist die EU mit den USA eine langfristige Vereinbarung zum Import von LNG eingegangen mit steigenden Mengen! Auch viele deutsche Energieunternehmen wie EnBw, RWE und SEFE haben inzwischen Verträge zur langfristigen Abnahme von LNG aus den USA unterschrieben und sich damit über Jahre, teils Jahrzehnte, zu fossilen Energieimporten verpflichtet. Bei diesen Lieferverträgen geht es um den Import von extrem klima- und umweltschädlichem Fracking-Gas. Neben den USA gibt es auch Vereinbarungen LNG aus einem neuen Gasfeld aus Katar nach Deutschland zu importieren. Dies ist symptomatisch für die Problematik des LNG-Hochlaufs: Neue Gasfelder werden erschlossen, was neue Treibhausgasemissionen und neue langfristige fossile Abhängigkeiten von einem zweifelhaften Regime bedeutet. Solche Projekte stehen entgegen der Empfehlung der Internationalen Energieagentur, keine neuen fossilen Projekte mehr zu beginnen, wenn es noch eine realistische Chance für die Einhaltung der 1,5°C Grenze geben soll.
Durch den Terminalbau drohen massive Schäden für unser Klima und den sensiblen Lebensraum der Nord- und Ostsee. Geschützte Unterwasser-Biotope sowie Brut- und Rastplätze für Vögel werden geschädigt. Die mit dem Bau und dem Betrieb verbundenen Lärmemissionen können bei heimischen Meeressäugern, wie dem gefährdeten Schweinswal, zu schweren Hörschäden, Desorientierung und sogar zur Trennung von Mutter und Kalb führen.
Doch nicht nur in Deutschland haben die LNG-Pläne dramatische Folgen: In den USA wird ein Großteil des geförderten Erdgases durch die extrem umweltschädliche Technik des Frackens gewonnen. Um dieses Gas zu gewinnen, wird ein Chemikalien-Gemisch mit Druck in den Untergrund gepresst, um gashaltiges Gestein aufzubrechen. Diese Praxis ist höchst umweltschädlich. In Deutschland ist unkonventionelles Fracking deshalb verboten. Der Wasserbedarf von Fracking ist zudem enorm und kann zu einer Konkurrenzsituation mit dem Bedarf der Landwirtschaft führen. Das Frackfluid enthält Chemikalien, die zu schwerwiegender (Grund-)Wasserverschmutzung führen kann – ein Teil davon verbleibt permanent im Boden. Zudem kann Fracking Erdbeben verursachen. 70 % der gesamten Gas-Produktion in den USA kamen 2021 aus Fracking-Quellen.
Wer US-amerikanisches LNG importiert, kauft also ziemlich sicher Fracking-Gas. Fracking hat neben extremen umweltschädlichen auch gesundheitliche Folgen wie Krebs- und Atemwegserkrankungen. Da Fracking hauptsächlich an Orten betrieben wird, an denen vor allem einkommensschwächere Menschen leben, sind in den USA hiervon überproportional häufig schwarze und indigene Menschen (BIPoC) betroffen. Dieses Phänomen wird Umweltrassismus genannt. Dass Deutschland aus genannten Gründen selbst ein Fracking-Verbot hat und nun Fracking-Gas aus kolonial geprägten Strukturen importiert, lehnen wir als Deutsche Umwelthilfe ab.
Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass die LNG-Terminals für Wasserstoff oder seine Derivate genutzt werden können. Insbesondere für FSRUs ist die Umrüstung nach derzeitigem Wissenstand nicht möglich und eine Umrüstung von landseitigen Terminals ist nicht sichergestellt. Außerdem enthalten die Genehmigungen für LNG-Infrastruktur keine spezifischen Anforderungen hinsichtlich der Möglichkeit einer Umstellung auf Wasserstoff. Stattdessen werden die Lieferverträge für LNG für mehrere Jahre abgeschlossen, was eine langfristige Bindung an den Betrieb mit LNG und nicht mit Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten bedeutet.
Bei den bisherigen Genehmigungsverfahren für LNG-Terminals und die dazugehörende Infrastruktur, insbesondere die Anschlusspipelines, haben es die Genehmigungsbehörden der Zivilgesellschaft sehr schwer gemacht, sich an den Verfahren zu beteiligen. Konkret bedeutete das, dass die teils mehrere tausend Seiten umfassenden Antragsunterlagen häufig nur in einfacher Ausführung in den Räumlichkeiten der entsprechenden Behörde für 1-2 Wochen zur Einsicht auslagen oder in digitaler Form nicht barrierefrei waren. Durch das LNGG wurde die Beteiligungsfrist außerdem erheblich verkürzt, so dass der Zivilgesellschaft häufig nur eine Woche Zeit blieb, die Unterlagen zu sichten. Der Zivilgesellschaft wurden so bewusst Steine in den Weg gelegt, um die Genehmigungsverfahren für LNG-Terminals und -Infrastruktur möglichst widerstandsfrei und schnell abzuschließen. Das ist undemokratisch und gefährlich. Denn durch Einwände von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Anwohner*innen werden Perspektiven und Positionen sichtbar, die den Genehmigungsprozess mit konstruktiven Anregungen bereichern. So können wichtige Aspekte, die aus diversen Gründen in den bisherigen Planungen unberücksichtigt blieben, noch aufgenommen werden.
Die DUH unterstützt die Zivilgesellschaft an den LNG-Standorten beim Widerstand gegen die klimaschädliche Infrastruktur. Dafür hat die DUH beispielsweise gemeinsam mit anderen NGOs und Bürgerinitiativen in Wilhelmshaven und auf Rügen alternative Erörterungstermine organisiert, bei denen die Bürger*innen informiert sowie ihre Fragen und Kritik dokumentiert und an die Bundesregierung sowie die Genehmigungsbehörden weitergegeben wurden. Während der Verhandlungen über eine Aufnahme von Mukran in das LNG-Beschleunigungsgesetz hat die DUH gemeinsam mit Bürger*innen Aktionen vor dem Bundeskanzleramt, dem Bundestag und Bundesrat organisiert, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen und Politiker*innen dazu zu bewegen, sich gegen dieses Vorhaben zu stellen.
Außerdem unternimmt die DUH vielfältige rechtliche Schritte, um gegen die LNG-Pläne der Bundesregierung vorzugehen. Dazu zählen Einwendungen und Widersprüche während der Genehmigungsverfahren sowie Klagen. Die DUH hat zudem verschiedene Gutachten und Studien in Auftrag gegeben, die die mangelnde Notwendigkeit des LNG Hochlaufs darstellen.
Frackinggas-Importe stoppen!
Wir fordern ein Importverbot für schädliches Frackinggas.
Kontakt
 © Finke/DUH
© Finke/DUH Constantin Zerger
Bereichsleiter Energie und Klimaschutz
E-Mail: Mail schreiben

Milena Pressentin
Referentin Energie & Klimaschutz
E-Mail: Mail schreiben